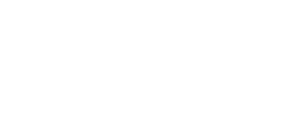Kirchen betonen gemeinsame Verantwortung für die Schöpfung

Unter dem Motto "Gemeinsame Verantwortung für die Schöpfung" stand am Freitagnachmittag in der Wiener Jesuitenkirche der diesjährige Gottesdienst zur Schöpfungszeit des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ), der gemeinsam mit den Umweltbeauftragten der Katholischen und Evangelischen Kirche Österreichs sowie Vertreterinnen und Vertretern der "Religions for Future" stattfand.
Dem Gottesdienst standen der Wiener katholische Weihbischof Stephan Turnovszky, die methodistische Pastorin Esther Handschin und der rumänisch-orthodoxe Bischofsvikar Nicolae Dura vor. Inhaltlich stand die vor zehn Jahren veröffentlichte Umwelt- und Sozial-Enzyklika "Laudato si" von Papst Franziskus (2013-2025) im Mittelpunkt.
Drei zentrale Passagen aus der Enzyklika bildeten das Gerüst des Gottesdienstes: die päpstliche Kritik an Vorstellungen eines grenzenlosen Wachstums, die spirituelle Einsicht, dass weniger mehr ist, und die Erkenntnis, dass alles miteinander verbunden ist. Weihbischof Turnovszky rief in seinen Gedanken dazu auf, dieser in der Liebe Gottes zu allen Menschen und allen Geschöpfen gründende Verbundenheit aufmerksam nachzuspüren. Jeder Mensch auf Erden sei Ausdruck der Liebe Gottes. Wenn man das ernst nimmt, bewahre es davor, Menschen nach bestimmten Kategorien einzuteilen, "denn jede und jeder ist eine Knospe an der Wirklichkeit Gottes".
"Wir besitzen nicht, was uns anvertraut wurde"
Die Bibel leite mit ihren Geboten und Geschichten in vielfältiger Weise zu einem guten menschlichen Miteinander an, so Pastorin Handschin in ihrem Impuls. Die Haltung, alles nur für sich selbst haben zu wollen, zerstöre hingegen die Lebensgrundlage aller. Die biblische Perspektive sei klar: "Wir sind die Verwalterinnen und Verwalter. Wir besitzen nicht, was uns anvertraut wurde." Es gehe vielmehr um eine fürsorgliche Haltung innerhalb der menschlichen Gemeinschaft für alles Leben auf der Erde.
In die gleiche Kerbe schlug auch Bischofsvikar Dura. Die Trennung von Gott führe zu einer besitzergreifenden und ausbeuterischen Haltung und Verhaltensweise gegenüber der Schöpfung und den Mitmenschen. Das Leben in Christus sei hingegen die Quelle von Umweltbewusstsein und philanthropischem Handeln. Wer ein Verbrechen gegen die Natur begeht, versündige sich auch gegen sich selbst und gegen Gott. Eindringlich plädierte Dura zu einer Rückkehr zu einem einfacheren Lebensstil: "Weniger Ego, mehr Christus in uns. Weniger Ablenkung, mehr Gottesnähe. Weniger Besitz, mehr Freiheit für Gott. Weniger Worte, mehr Gebet."
"Die Zukunft des Lebens auf der Erde werde entweder ökologisch und friedlich sein, oder es wird kein Leben mehr geben", zitierte Dura zudem den Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I.
Auch ein Vertreter des Buddhismus sprach bei dem Gottesdienst Gedanken der Verbundenheit und alle Teilnehmenden beteten u.a. das in "Laudato si" enthaltene interreligiöse "Gebet für die Erde".
"Sorge für das gemeinsame Haus"
Am 18. Juni 2015 veröffentlichte Papst Franziskus die Enzyklika "Laudato si - Über die Sorge für das gemeinsame Haus". Mit dem Lehrschreiben wandte er sich nicht nur an die Gläubigen, sondern an "alle Menschen guten Willens". Die Enzyklika thematisiert die aktuellen ökologischen und sozialen Krisen in großer Deutlichkeit und fordert eine ganzheitliche Ökologie, die Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft und Spiritualität zusammen denkt.
Laudato si wurde weltweit beachtet, politisch wie religiös diskutiert und hat zahlreiche Prozesse in Kirche, Zivilgesellschaft und Politik angestoßen. Der Begriff der "ökologischen Umkehr" ist seither zu einem Leitmotiv kirchlicher Umweltarbeit geworden. Franziskus hatte in seinem Schreiben dafür plädiert - konkret für eine "kulturelle Revolution" im Umgang mit Natur und Mitmenschen, die sich nicht in technischen Lösungen erschöpfen dürfe, sondern auf innerer Umkehr und einer neuen Lebensweise beruhe.
Schöpfungszeit bis 4. Oktober
Seit 2015 ist der ökumenisch begangene "Schöpfungstag" am 1. September offiziell als "Weltgebetstag für die Schöpfung" im katholischen Kalender eingetragen. Bereits 1989 hatte der damalige Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Dimitrios I., "die ganze orthodoxe und christliche Welt" eingeladen, am 1. September "zum Schöpfer der Welt zu beten: mit Dankgebeten für die große Gabe der geschaffenen Welt und mit Bittgebeten für ihren Schutz und für ihre Erlösung". Diese Initiative wurde 1992 von der gesamten orthodoxen Kirche begrüßt und übernommen, katholische und evangelische Ortskirchen folgten.
2007 weitete die dritte Europäische Ökumenische Versammlung in Sibiu/Hermannstadt (Rumänien) dies aus und empfahl, "dass der Zeitraum zwischen dem 1. September und dem 4. Oktober dem Gebet für den Schutz der Schöpfung und der Förderung eines nachhaltigen Lebensstils gewidmet wird, um den Klimawandel aufzuhalten".
Als besondere kirchliche Mahner für mehr Schöpfungsverantwortung gelten Papst Franziskus und Patriarch Bartholomaios I., der Nachfolger von Dimitrios auf dem Patriarchensitz in Konstantinopel. Nicht zufällig hat Franziskus in seiner Enzyklika "Laudato si" den "grünen Patriarchen" als Vorbild hervorgehoben.