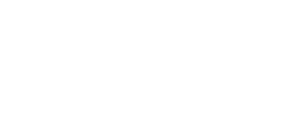Ökumenisches Begleitprogramm in Palästina und Israel
des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich
Der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich ist ein Gremium, in dem christliche Kirchen zusammenkommen, um Themen zu beraten, die alle gemeinsam betreffen. Er ist die Stimme, mit der die Kirchen dann sprechen, wenn deutlich zum Ausdruck kommen soll, dass sie trotz aller Unterschiede und Kontroversen durch eine gemeinsame und tragfähige Basis verbunden sind.
ÖRKÖ-NEWS

Ökumenischer Rat setzt auf ökumenische Impulse von Papst Leo XIV.

Erklärung des ÖRKÖ-Vorstands zur Papst-Wahl
TERMINE
ÖRKÖ-Spendenprojekt 2025
Der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) führt jedes Jahr ein besonderes Spendenprojekt durch. 2025 wollen die Kirchen in Österreich gemeinsam in Haiti helfen.
Alle Infos
Ökumene-NEWS (Österreich & International)

Der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) unterstützt das Ökumenische Begleitprogramm in Palästina und Israel (EAPPI) des Weltkirchenrates
>> Alle Infos
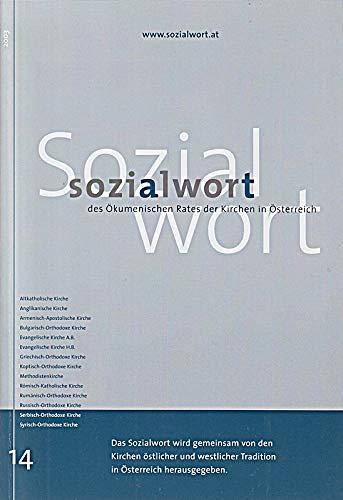
Im Sozialwort aus dem Jahr 2003 nehmen die Kirchen östlicher und westlicher Tradition in Österreich gemeinsam Stellung zu den sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen.
Das Sozialwort versteht sich als Kompass in einer Gesellschaft, die sich in einem tiefgreifenden Wandel befindet: In den Bereichen Bildung, Medien, Arbeit, Wirtschaft, soziale Sicherheit und Ökologie. Das Sozialwort benennt konkrete Aufgaben für Kirchen und Politik/Gesellschaft.
Das Sozialwort ist in einem vierjährigen Prozess (2000 - 2003) entstanden.
Das "Sozialwort" zum Download finden Sie HIER

Die 11. Vollversammlung des Weltkirchenrates verabschiedete vier öffentliche Erklärungen, vier Protokollpunkte, eine Botschaft und eine Erklärung, in denen sie Wege zur Bewältigung einiger der größten Herausforderungen der Welt vorschlug.